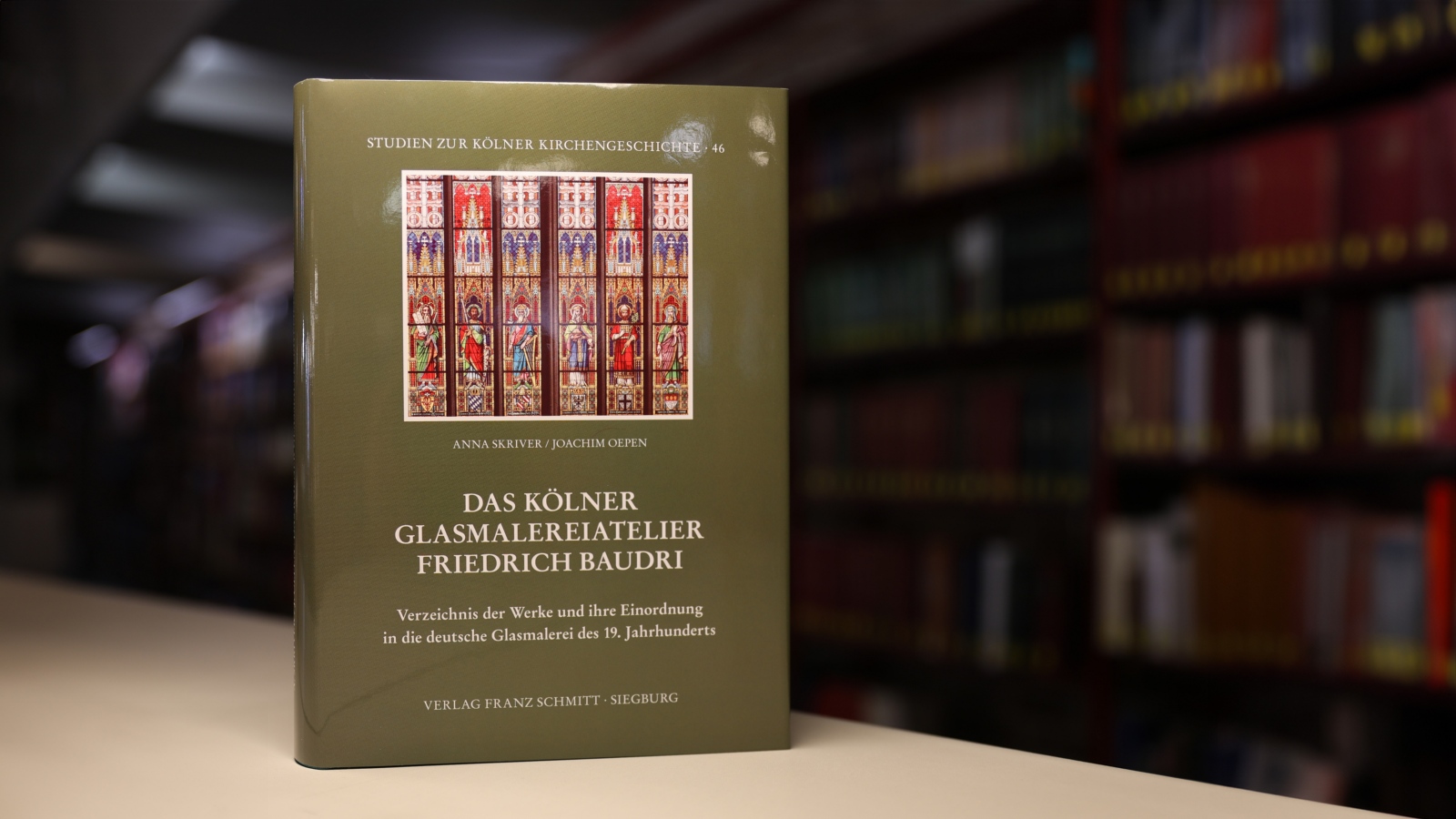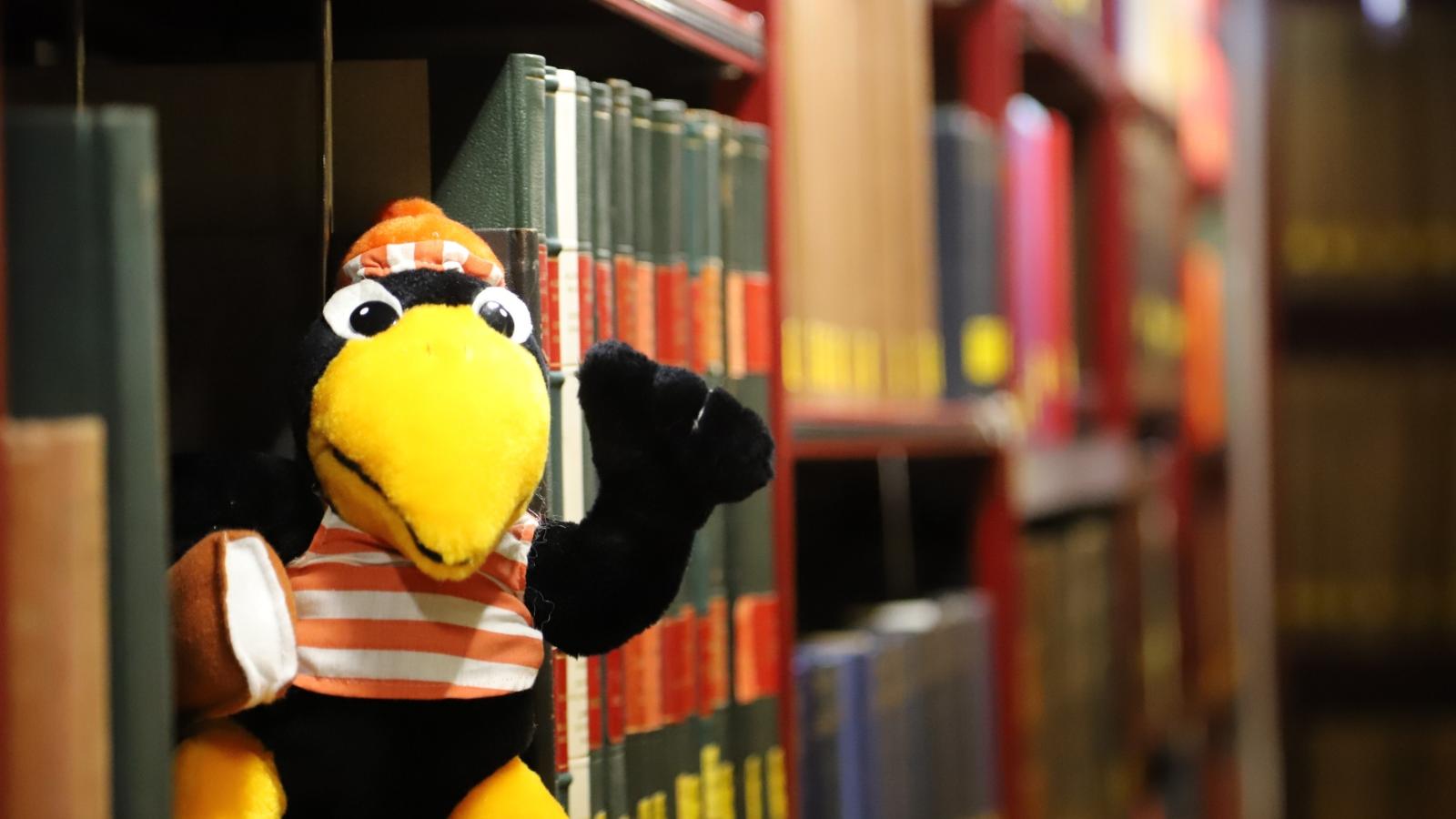Zwischen Kohleabbau und Rekultivierung:Weihbischof Steinhäuser und Kerpener Gläubige besuchen Tagebau Hambach
Erde, Sand und Stein, soweit das Auge reicht. Wo in knapp 50 Jahren der tiefste See Deutschlands entstehen soll, liegt heute der Tagebau Hambach. Umrandet von Erdstufen in unterschiedlichsten Braunnuancen wird in der rund 420 Meter tiefen Grube noch bis 2030 Braunkohle abgebaut. Doch wo etwas endet, soll auch etwas Neues beginnen: ein Seehafen inmitten von rekultivierten Grün- und Waldflächen.
Eine besondere Exkursion
Im Rahmen seiner Visitation im Seelsorgebereich Kerpen-Südwest wurde Weihbischof Rolf Steinhäuser zu einem besonderen Ausflug eingeladen. Pfarrer Ludger Möers organisierte gemeinsam mit dem Pfarrgemeinderat Horrem-Sindorf sowie dem Kirchenvorstand von St. Martinus eine Exkursion zum benachbarten Tagebau Hambach. Unter der Leitung von zwei Mitarbeitern des Energiekonzerns RWE Power AG, Norman Stamm, Referent für Energieverteilnetze Tagebaue und Kraftwerke, und Gregor Eßer, Leiter der Forschungsstelle Rekultivierung, führte die Gruppe eine Tour in einem geländegängigen Bus durch den Tagebau.
Die Dimensionen des Tagebaus
Schon beim ersten Stopp wird die enorme Größe des Geländes deutlich: Der Tagebau erstreckt sich über eine Fläche von sechs mal acht Kilometern. Die Grube ist unterteilt in eine Gewinnungs- und eine Verkippungsseite, die von mehreren Förderbändern umgeben ist. In etwa 400 Metern Tiefe befindet sich die rund 70 Meter mächtige Braunkohleschicht. Um an diese zu gelangen, werden sieben Schaufelradbagger benötigt. „Fünf Bagger buddeln Sand, und zwei Bagger graben abwechselnd Sand und Kohle“, erklärt Norman Stamm. Der Abraum und die Kohle werden etappenweise gefördert, was die treppenartige Form der Grube erklärt. Nach dem Ende der Braunkohleförderung müssen die Böschungen abgeflacht werden, bevor Wasser in die Grube einlaufen kann, um den geplanten See zu errichten.
Kohleabbau und erneuerbare Energien
Bis zum Ende des Tagebaus wird weiterhin Braunkohle für die Energieversorgung gefördert. Aktuell sind es rund 15 Millionen Tonnen pro Jahr – noch vor fünf Jahren war es doppelt so viel. „Zwar fördern wir noch Kohle, doch unser Blick geht auch nach vorne. Deshalb setzen wir bereits jetzt auf erneuerbare Energien, auch hier in Hambach“, erklärt Stamm und zeigt auf die Verkippungsseite, wo eine Reihe an Photovoltaikanlagen angebracht ist. Hier werden aktuell 50 Megawatt Strom erzeugt und zukünftig gespeichert. Im rheinischen Revier sollen auf den Flächen der Tagebaue weitere rund 500 Megawatt erneuerbare Energien installiert werden.
Begegnung mit dem Schaufelradbagger
Auf holprigen Matschstraßen geht es weiter zur Gewinnungsseite. Hier erwartet die Gruppe das größte fahrbare Arbeitsgerät der Welt: der Schaufelradbagger. Die knapp hundert Meter hohe Maschine ist mit einem drehenden Rad ausgestattet, an dem sich mehrere Baggerschaufeln befinden. Diese lösen und transportieren die Erde sowie die Kohle. Das abgebaute Material wird über ein Förderband, das mit etwa 30 km/h läuft, abtransportiert. An einem Fließbandkreuz, das wie eine Matrix aufgebaut ist, dem sogenannten Bandsammelpunkt, werden anschließend Braunkohle und Erde verteilt.
Auswirkungen auf die Kerpener Gemeinde
Für die Kerpener Gruppe ist der Hambacher Tagebau Teil ihrer Lebensrealität. Der Seelsorgebereich grenzt direkt an das Braunkohlerevier. Im Zuge der Erweiterung der Abbauzone musste Manheim-Alt umgesiedelt werden. Der Großteil der Bewohnerinnen und Bewohner zog um, und die Kirche des Stadtteils wurde 2019 profaniert. Als Ersatz entstand westlich von Kerpen der neue Umsiedlungsort Manheim, in dem die Gläubigen eine neue Kapelle erhielten, berichtet Pfarrer Ludger Möers.
Rekultivierung und Naturschutz
Neu entstanden sind auch zahlreiche Wald- und Grünflächen. Hinter der Verkippungsseite des Tagebaus erhebt sich die Sophienhöhe, die mit dem Abraum des Tagebaus geschaffen wurde. Neben Wäldern und Obstwiesen sind hier rund 120 Kilometer frei zugängliche Wanderwege entstanden, darunter ein Kreuzweg. Die Rekultivierung erfolgt nach dem seit 2018 festgelegten Biodiversitätsstandard von RWE.
Viele wissen nicht, dass Rekultivierung im Rheinland bereits seit fast 100 Jahren praktiziert wird und ca. 20.000 Hektar Fläche entstanden sind. Im Fall des Tagebaus Hambach begann die forstliche Rekultivierung kurz nach der ersten Abraumverkippung. So gibt es auf der Sophienhöhe bereits 45 Jahre alte Wälder. Neben der Flora haben sich auch zahlreiche Tierarten angesiedelt, darunter seltene Falter und Wildkatzen. Dabei erfolgte die Besiedelung oft ohne menschliches Zutun.
Insgesamt sind auf der Rückseite des Tagebaus rund 1.600 Hektar Fläche rekultiviert. Ein besonderes Highlight ist ein Mammutwald, der für ein Stück „Nordamerika-Feeling“ sorgt, wie Gregor Eßer lachend erzählt. Als Leiter der Forschungsstelle Rekultivierung erklärt er, wie Baumstämme als Lebensraum für Insekten auf dem Waldboden liegen bleiben, was wiederum neue Tierarten anlockt. Auch eine Ganzjahresbeweidung durch Wildpferde hilft, das Grasland auf natürliche Weise frei von Sträuchern und Bäumen zu halten.
„Die Rekultivierung betrachte ich als einen Großversuch“
Für Weihbischof Steinhäuser war es nicht der erste Besuch im Tagebau Hambach. Vor sieben Jahren war er bereits einmal hier, damals jedoch nur für einen kurzen Aufenthalt. Dieses Mal erhielt er einen umfassenden Einblick in den Tagebau und seine Auswirkungen. „Eine so großräumige Umgestaltung einer Landschaft ist natürlich faszinierend. Doch unter ökologischen Aspekten sind Tagebaue auch umstritten. Die Rekultivierung betrachte ich als einen Großversuch, den ich mit Interesse, aber auch mit einer gewissen Skepsis beobachte“, so der Weihbischof.
Segnung der Heiligen Barbara
Ein besonderes Highlight des Tages war die Segnung einer Plakette mit der Darstellung der Heiligen Barbara. Norman Stamm ließ diese im Beisein der Gruppe von Weihbischof Steinhäuser segnen. Als Schutzpatronin der Bergleute kommt ihr in Bergbaugebieten eine große Bedeutung zu. So auch für den Referenten für Energieverteilnetze Tagebaue und Kraftwerke, der die gesegnete Plakette nun in seinem Büro hängen hat.
Blick in die Zukunft
Wenn 2030 die letzte Braunkohle abgebaut wird, endet die Ära des seit 1978 betriebenen Tagebaus Hambach. An seiner Stelle wird ein See mit zunächst drei Landzungen entstehen. Bis der See vollständig gefüllt ist, werden noch knapp 50 Jahre vergehen. Dann wird er nach dem Bodensee der zweitgrößte See Deutschlands sein. Doch bis dahin muss noch eine 46 km lange Pipeline errichtet werden, die Rheinwasser in die Seegrube transportiert. Eine erste Nutzung dieser Naherholungsseeoberfläche ist für das Jahr 2040 geplant.
Aktuelle Nachrichten aus dem Erzbistum Köln
Pressemitteilungen
Alle Pressemitteilungen des Erzbistums Köln finden Sie im Pressebereich.
Suche innerhalb der News
Service und Kontakt
Service und Kontakt
Pressekontakt
Geschäftszeiten
Pressekontakt
Geschäftszeiten
Mo-Do: 8.30 - 17 Uhr
Fr: 8.30 - 14 Uhr
Erzbistum Köln
Newsdesk